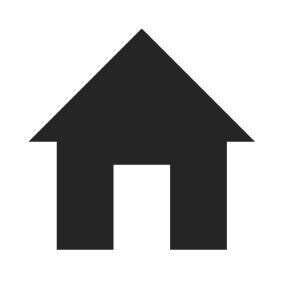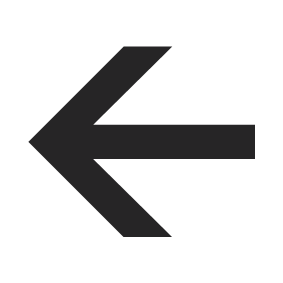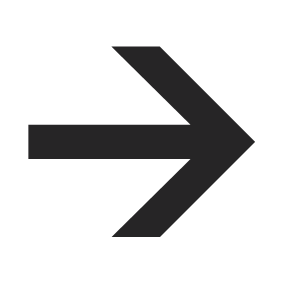Auferstehungs-Christus
Eine schlichte, schwarze Metallfigur hüpft leicht in die Höhe. Auf ihren beiden Handflächen und Fussrücken wie auch an ihrer rechten Brust befinden sich je ein rot eingefärbter Krater (Wundmale = Mal der Nägel (Joh 20,25b)).

Der Auferstehungs-Christus zeigt den Moment im Leben Jesu, in dem Gott Jesus von den Toten zu den Lebenden auferweckt hat.
Im Osterlied «Christus ist auferstanden!» (Kirchengesangbuch Nr. 450, S. 523 = KG 450) besingen wir, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus kommt vom Liegen als Toter zurück ins Stehen, Gehen und Tanzen als Lebender.
Die Verehrung der Wundmale Christi setzte im 13. Jahrhundert in der Westkirche so richtig ein. Ein Auslöser dazu war, dass Franz von Assisi (um 1881–1226) gegen Ende seines Lebens die Wundmale Christi an Händen und Füssen erhielt (= Stigmatisierung).
In der Kirche St. Johannes wird Jesus in drei unterschiedlichen Momenten seines Lebens dargestellt:
- Bei der Muttergottes sitzt er als Kleinkind auf dem Schoss seiner Mutter.
- Am Kreuz hängt der zu Tode verurteilten Jesus und wir nehmen sein grausames Leiden und seinen Todeskampf wahr.
- Der Auferstehungs-Christus zeigt den Moment, in dem Gott Jesus von den Toten zu den Lebenden auferweckt hat.
Künstler
unbekannt
Die Figur bildet mit ihrem Körper ein verschobenes Kreuz. Die Arme, welche am Kreuz waagrecht zum Körper an den Kreuzbalken genagelt wurden, sind in Bewegung geraten. Der linke Arm ist angewinkelt, und seine Hand bildet zusammen mit dem Kopf und der rechten Hand eine Diagonale, welche von links unten nach rechts oben geht. Die Bewegung von unten nach oben zeichnet die Auferstehung von den Toten nach: aus dem Grab wieder hinauf auf die Erde, an die Erdoberfläche.
Von der dargestellten Person aus gedacht, steht die linke, tiefere Hand für die Vergangenheit, also den Tod am Kreuz, während die rechte, hochgestreckte Hand für die Zukunft, die Rückkehr zum Vater steht. Jesus verbindet mit seinem Gestus gestern und morgen und lebt selbst im Heute.
Die Haut seiner Füsse und Beine ist mit symbolisierten Blüten übersät. Die Mitteilung dieser «erblühten Haut»: Der Auferstehungs-Christus erblüht zu neuem Leben. Und wie es bei echter Kunst schon immer war: Was man (genauer) sieht, wird genauer ausgearbeitet. Steht man von dem Auferstehungs-Christus, so sieht man bei gerader Kopfhaltung nur die Füsse und Beine. Um mehr zu sehen, muss man den Kopf in den Nacken legen und sieht dadurch etwas ungenauer. Deshalb nimmt die Blütenornamentik auf der Haut vom Oberkörper Richtung Arme immer mehr an Detailreichtum ab.
Im scharfen Kontrast zu dieser floralen Haut der Füsse und Beine stehen die dreieckigen, tiefen Wundmale, die wie eine umgedrehte dreiseitige Pyramide sind. Doch diese Male sind nicht dunkel, wie sie durch gestocktes und getrocknetes Blut würden, sondern sie strahlen von innen heraus. Zuinnerst sind sie tief karminrot, danach orange und zum Schluss teilweise maisgelb.
Im Osterlied «Freu dich erlöste Christenheit» (Kirchengesangbuch Nr. 452, S. 525 = KG 452) singen wir in der 3. Strophe: «Die Wunden sind verkläret ganz». Der Ausdruck der verklärten Wunden stammt nicht aus der Bibel, sondern aus der Volksfrömmigkeit.
Passende Bibelstelle
Thomas entgegnete den anderen Jüngern: «Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht an das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.» (Johannes, Kapitel 20, Vers 25b = Joh 20,25b)
Dann sagte Jesus zu Thomas: «Streck deine Finger hierher aus und sieh meine Hände! Steck deine Hand aus und leg sie in meine Seite.» (Johannes, Kapitel 20, Vers 27 = Joh 20,27)